
- VERLAG
- MYTHOLOGIE
- DER PFAD DES WISSENS
- SHOP
- KONTAKT

Die Vorstellung der Wikinger als reine Axt- und Schwertkämpfer ist verbreitet – doch ihre Welt war auch eine der Netze, Seile und feiner Handwerke. Das Wurfnetz (altnordisch etwa vefjarnet oder schlicht net) war ein vielseitiges, effizientes Werkzeug: von der Fischerei und Jagd bis hin zu überraschenden Einsätzen im Krieg. Es war kein glorifiziertes Kriegsgerät wie Mjölnir im Mythos, doch seine Wirksamkeit lag in Geschicklichkeit, Taktik und der engen Verbindung von Technik und Alltag. Im folgenden Artikel betrachten wir den Wurfnetzgebrauch bei den Wikingern aus allen Perspektiven: Bauweise, Materialien, Einsatzarten, archäologische Spuren sowie moderne Rekonstruktionen.
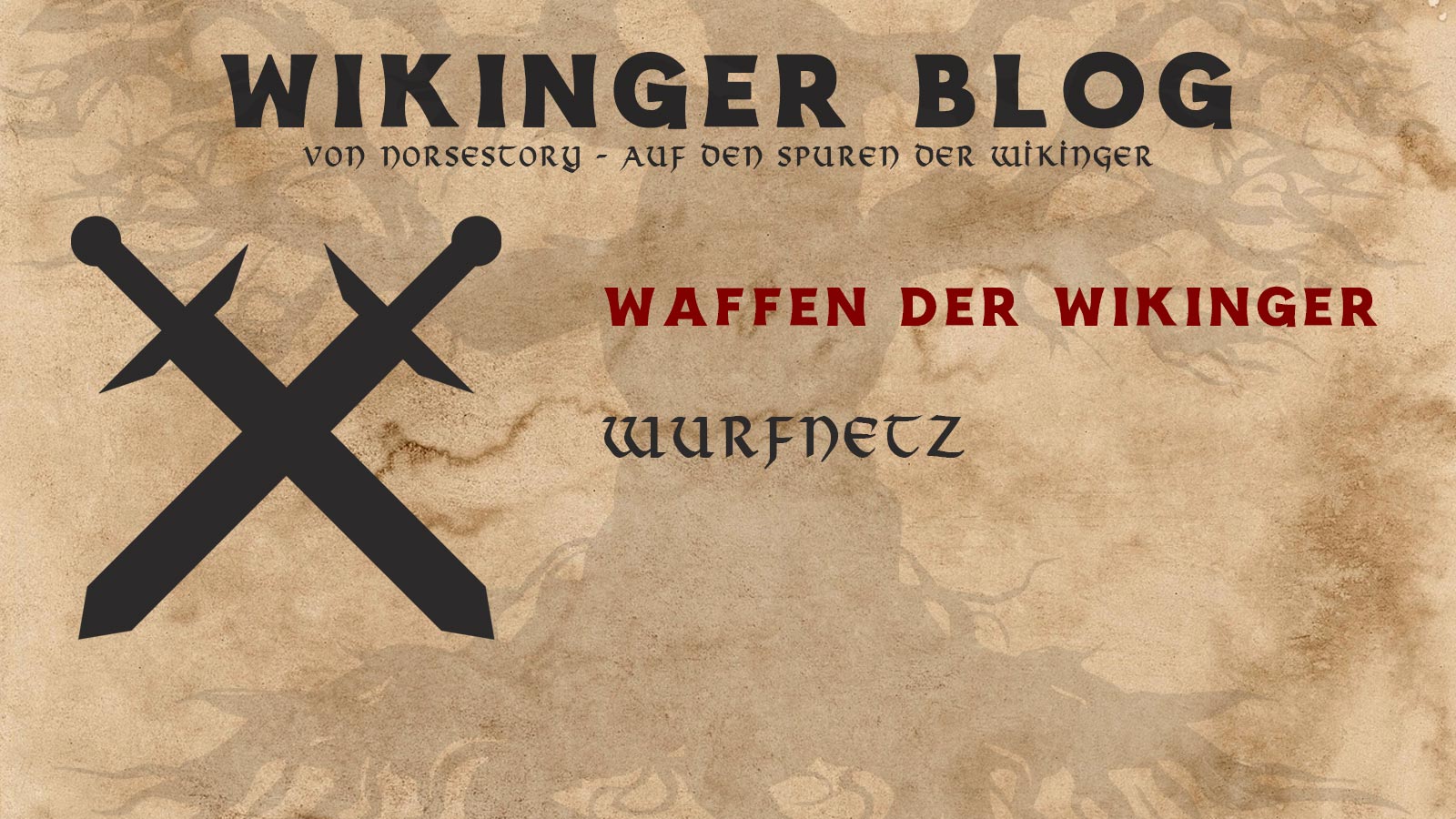
Ein Wurfnetz ist auf den ersten Blick ein simples Objekt: ein kreis- oder halbkreisförmiges Netz mit einem Gewichtsaum und oft mit Leinen- oder WurfKnoten versehen. Doch die wirkliche Kunst lag in Maß, Knotenbild und Materialwahl.
Traditionell bestanden die Netze aus pflanzlichen Fasern wie Leinen (Flachs), Hanf oder seltener aus Tiersehnen, je nach Verfügbarkeit. Leinen war in Skandinavien weit verbreitet und bot eine gute Kombination aus Festigkeit und Dehnbarkeit. Die Netzmaschen wurden in festen, sich wiederholenden Knoten gebunden, die beim Auswerfen das Öffnen des Netzes und das schnelle Zusammenfallen gewährten. Um die Form beim Wurf zu stabilisieren, wurden Netzgewichte (kleine Stein- oder Bleigewichte, später auch Keramik- oder Knochenbeschwerungen) entlang des Saums befestigt. Diese Randschnüre trugen zugleich das Wurfseil, an dem man das Netz zog und so das Gefangene einschloss.
Die Größe variierte stark: kleine, einhändig geworfene Netze dienten der Vogel- oder Kleinwildjagd; größere Wurfnetze, die von Booten aus über Fischschwärme geschleudert wurden, erreichten mehrere Meter Durchmesser.
Der häufigste Einsatz des Wurfnetzes war die Fischerei. Von Uferstellen, Flussmündungen oder kleinen Booten aus warfen die Wikinger Netze über enge Schwarmverbände – eine Methode, die überraschend ertragreich und ressourcenschonend war. In flachen Küstenzonen eignete sich das Netz hervorragend für Heringe, Kabeljau und andere Schwarmfische; in Flüssen wurden Lachse und Forellen auf diese Weise gegriffen.
Für die Jagd wurden kleinere, feiner maschige Wurfnetze genutzt, um Vögel aus den Büschen oder Rebhühner in offenen Flächen zu fangen. Normanische und angelsächsische Quellen belegen diese Technik in Nordeuropa; die Wikinger übernahmen und perfektionierten ähnliche Methoden.
Das Netz war ökonomisch: es ließ sich mehrfach verwenden, reparieren und anpassen. Für die Siedlungen war das Wurfnetz daher ein elementares Instrument der Subsistenzwirtschaft.
Weniger bekannt, aber historisch plausibel ist der Einsatz von Wurfnetzen in militärischen Kontexten. Quellen aus späteren mittelalterlichen Kontexten und vergleichende Ethnographie zeigen, dass Netze auf See und an Bord in mehreren Kulturen für folgende Zwecke genutzt wurden:
Deckung und Verhinderung von Bewegung: Ein über einen Feind oder eine Gruppe geworfenes Netz entzieht dem Gegner Mobilität; Beine und Waffen können verfangen, Ordnung und Formation brechen.
Enge Kämpfe auf Schiffen: Bei Entermanövern, wenn zwei Schiffe dicht aufeinander liegen, ermöglicht das Netz, Gegnern Waffen aus der Hand zu schlagen oder sie vorübergehend zu binden – eine Form der Deeskalation, bis man nachsetzt.
Anti-Pfeil- und gegnerische Geschosse: In manchen Quellen tauchen Netze als Teil von Schutzvorrichtungen auf, die kleine Projektile abfangen sollen.
Fang von Reitern und fliehenden Gegnern: Auf offenem Feld funktionieren Wurfnetze weniger gut, doch in engen Passagen, bei Treibjagden oder beim Fang von Feinden aus versteckter Position waren sie effektiv.
Taktisch war das Netz für die Wikinger ein Instrument des Überraschungsangriffs: schnell, billig und psychologisch wirksam. Ein überrascht gefesselter Gegner verlor zumeist seine Kampffähigkeit schneller als jemand, der von einer Klinge getroffen wurde.
Der Erfolg mit dem Wurfnetz hing stark von Technik. Ein korrekt getimter Wurf erforderte Timing, Augenmaß und Übung. Übliche Technik: das Netz mehrfach in quergelegten Schleifen über der Schulter halten, einen energischen Halbkreis mit dem Arm ziehen und das Netz mit einem Schwung öffnen. Bei großen Netzen wurden oft zwei Werfer synchron aktiv. Trainingsübungen umfassten Zielwerfen, Wurfroutinen mit variablen Gewichten sowie Reparaturkenntnisse.
Die Wikinger kannten das Prinzip des Schnellziehens: Nach dem Werfen zogen sie an einer Leine, um die Gewichte näher zusammenzuführen und das Netz zu schließen – eine Technik, die bei Fischern und bei Kämpfern gleichermaßen Anwendung fand.
Direkte Netzreste sind wegen der Vergänglichkeit organischer Fasern selten. Trotzdem liefern diverse Funde und Darstellungen stichhaltige Indizien:
Netzgewichte: Kleine Stein-, Knochen- oder Bleigewichte, die entlang eines Saumes befestigt waren, finden sich auf vielen Fundplätzen des Nordens. Solche Netzsinker sind ein klarer archäologischer Nachweis für Netzgebrauch.
Textilien und Werkzeuge: In gut erhaltenen Gräbern wie Oseberg sind Netzreste, Taue und Fischfanggeräte dokumentiert. Ebenso gibt es Funde in Siedlungen wie Birka und Haithabu, die Fischerei- und Netzausrüstung zeigen.
Bildliche Quellen: Runensteine, Bildsteine und Schiffsdekorationen stellen Szenen des Fischens und des Lebens am Wasser dar; manche Reliefs deuten auf Netzgebrauch hin. Auch spätere mittelalterliche Manuskripte und Mönchsschriften erwähnen Netze als herrschendes Werkzeug im Norden.
Vergleichsfunde: Ethnographische Parallelen in anderen Küstengesellschaften (z. B. im nördlichen Europa bis in die baltische Region) untermauern die Funktionalität und Verbreitung von Wurfnetzen.
Diese Belege zeigen: Wurfnetze waren integraler Bestandteil des materiellen Kulturerbes der Wikinger.
Netzknüpfen war ein geschätztes Handwerk, oft Frauenarbeit, aber auch Teil von spezialisierten Handwerksgruppen. Die Fähigkeit, Maschen zu reparieren, Knoten zu setzen und das Netz wetterfest zu machen, war überlebenswichtig. Vor einer Seefahrt oder vor einer Raubfahrt gehörte das Netz zum Standardarsenal. In manchen Regionen konnten die besten Netzerzeuger ein hohes Ansehen genießen, weil sie Nahrungsgrundlagen sicherten.
Heute werden Wurfnetze in Rekonstruktionen und bei historischen Reenactments getestet. Solche Experimente bestätigen die Effektivität sowohl in der Fischerei als auch in speziellen militärischen Anwendungen – vorausgesetzt, das Gelände und die Taktik passen. Experimentalarchäologen stellen historische Netze nach, um Wurfweiten, Fangraten und Materialhaltbarkeit zu messen.
Das Wurfnetz war kein Instrument der glorreichen Einzelschlacht, aber ein Kernstück des Alltags und der Taktik: es fischte Nahrung, fesselte Gegner und spiegelte die handwerkliche Finesse der Wikinger. Seine Stärke lag in Vielseitigkeit, Instandsetzungsfähigkeit und ökonomischer Effizienz. Wo Schwerter Macht symbolisierten, sicherte das Netz das tägliche Brot – und im richtigen Moment konnte gerade dieses unscheinbare Werkzeug den Ausgang eines Gefechts verändern.
Entdecke die wundervolle Bücherwelt von NorseStory! Hochwertiges Design, fundierte belegbare Inhalte und die facettenreiche Welt der nordischen Mythologie.
Dir gefällt der Blog und der Verlag?
Dann unterstütze unsere Arbeit, Recherche und unser Projekt "NorseStory - auf den Spuren der Wikinger" gerne mit einer PayPal Spende. Jede Spende wird in den Verlag NorseStory investiert.
Ein paar weitere Leseempfehlungen für dich - oder wähle deine nächste Kategorie im Wikinger Blog:
Durchsuche den Wikinger Blog
Blog Kategorien
>> Blog Übersicht
>> Wikinger Runen
>> Wikinger Götter
>> Wikinger Symbole
>> Wikinger Welten
>> Wikinger Tiere
>> Wikinger Begriffe
>> Wikinger Kräuter
>> Wikinger Feiertage
>> Wikinger Geschichten
>> Wikinger Personen
>> Wikinger Waffen
>> Wikinger Rituale
>> Wikinger Berufe
>> Wikinger Edelsteine
>> Wikinger Ereignisse
>> Wikinger Farben
>> Deutsche Burgen
Verlag
Rechtliches
Mehr von uns