
- VERLAG
- MYTHOLOGIE
- SHOP
- KONTAKT

Die Kleidung der Wikinger fasziniert bis heute: kunstvolle Gewänder, verzierte Tuniken, farbenfrohe Stoffe und feine Details, die in Grabfunden und Bildquellen sichtbar werden. Hinter dieser Mode standen hoch spezialisierte Handwerker – die Schneider. Sie waren für mehr zuständig als nur das Nähen von Kleidungsstücken. Ihre Arbeit verband praktische Funktion, gesellschaftlichen Rang und symbolische Bedeutung. Vom Bauernhemd bis zum prunkvollen Mantel eines Jarls: Schneider prägten den Alltag und das Erscheinungsbild der nordischen Gesellschaft.
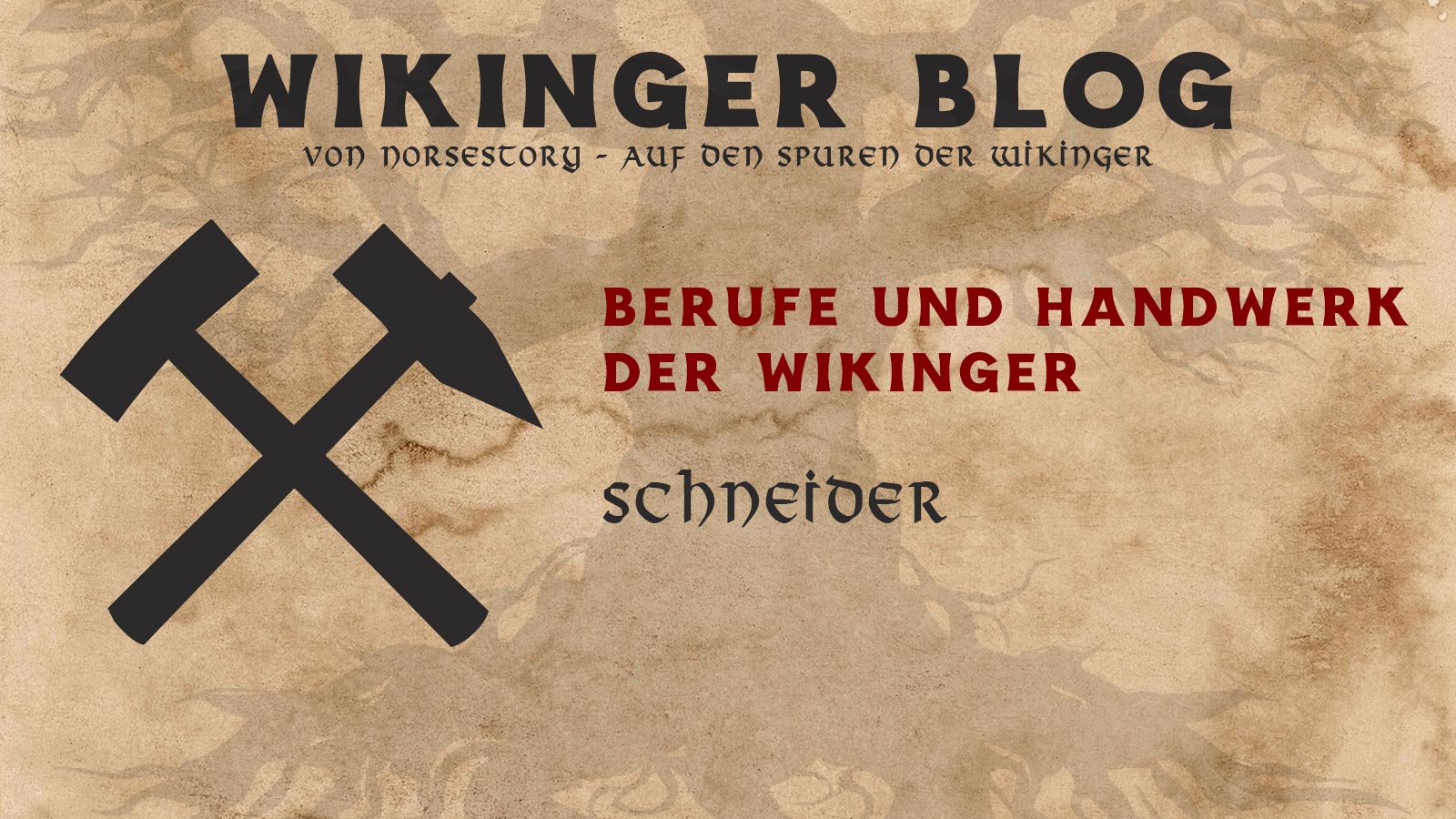
Der Schneider der Wikingerzeit fertigte Kleidung aus Wolle, Leinen und in seltenen Fällen aus importierter Seide. Er oder sie war dafür verantwortlich, dass Kleidung wetterfest, haltbar und zugleich repräsentativ war. Da Kleidung im Norden nicht nur Schutz vor Kälte bot, sondern auch den sozialen Status widerspiegelte, besaß der Schneider eine besondere Bedeutung.
Während einfache Tuniken, Hosen und Umhänge zu den Alltagsaufgaben gehörten, waren prunkvolle Mäntel mit Stickereien, Borten und Applikationen Ausdruck höchster Schneiderkunst. In gehobenen Schichten konnte der Schneider fast den Rang eines Kunsthandwerkers einnehmen, dessen Werk über Reichtum und Macht seines Auftraggebers Auskunft gab.
Die Tätigkeit der Schneider in der Wikingerzeit ist heute vor allem durch die archäologischen Funde von Werkzeugen und textilen Resten belegt. In zahlreichen Gräbern und Siedlungen fanden sich Scheren, Nähnadeln, Spinnwirtel und sogar Fingerhüte, die uns einen klaren Einblick in die Arbeitstechniken geben. Besonders interessant sind die Scheren, die meist aus Eisen gefertigt waren und in Gräbern von Frauen wie auch Männern gefunden wurden. Sie sind oft erstaunlich gut erhalten, etwa in den Siedlungsresten von Haithabu oder in den reichen Gräbern von Birka, und belegen, dass der Zuschnitt von Stoffen ein hochspezialisierter Vorgang war. Nähnadeln wurden aus verschiedenen Materialien hergestellt, darunter Eisen, Bronze und in einfacheren Ausführungen sogar aus Knochen. Diese Nadeln fanden sich häufig in Nadelkästchen, wie sie in Birka entdeckt wurden, was auf eine organisierte und gepflegte Handwerkstradition hindeutet. Auch Funde von Nadelbüchsen und Behältern mit mehreren Nadeln zeigen, dass die Wikinger Schneiderutensilien sorgfältig aufbewahrten und mit sich führten.
Neben diesen offensichtlichen Werkzeugen sind auch Webgewichte und Spinnwirtel wichtige Indizien für die textile Produktion, da sie den Vorlauf der Schneiderarbeit – das Spinnen und Weben der Stoffe – dokumentieren. Zwar gehörten diese Arbeitsschritte nicht zwingend in die Hände desselben Handwerkers, doch zeigen sie, wie eng der Prozess von der Rohstoffgewinnung bis zur fertigen Kleidung miteinander verbunden war. In einigen Fällen wurden auch Fingerhüte aus Bronze gefunden, beispielsweise in Haithabu, die belegen, dass Schneider bei feinen Näharbeiten nicht nur Werkzeuge, sondern auch Schutzhilfen nutzten. Besonders die Metallfunde geben einen Eindruck von der Professionalität, die hinter dem Schneiderhandwerk stand, und lassen Rückschlüsse auf spezialisierte Arbeitsbereiche zu.
Die Herstellung von Kleidung in der Wikingerzeit war ein komplexer Vorgang, der mit dem Spinnen und Weben der Stoffe begann und erst in der Werkstatt des Schneiders seine Vollendung fand. Wolle war dabei das wichtigste Material, da sie sich leicht färben ließ, gut isolierte und durch die Schafrassen Skandinaviens in großen Mengen zur Verfügung stand. Aus Flachs gewann man Leinen, das vor allem für Unterkleidung und Sommergewänder genutzt wurde. Besonders aufwändige Kleidungsstücke bestanden aus importierter Seide, die über weite Handelsrouten aus Byzanz und dem arabischen Raum nach Skandinavien gelangte. Seidenreste aus Birka und Oseberg belegen, dass diese Luxusstoffe nicht nur zu Zierzwecken, sondern auch als Einlagen und Applikationen verwendet wurden, oft mit Gold- oder Silberfäden kombiniert.
Die Schnitttechnik war auf Effizienz ausgelegt: Stoffbahnen wurden so zugeschnitten, dass möglichst wenig Verschnitt entstand. Typisch waren rechteckige oder dreieckige Stoffstücke, die zusammengesetzt wurden und den Körper weit und praktisch umhüllten. Daraus entstanden Tuniken, Hosen, Umhänge und Mäntel, die mit einfachen, aber haltbaren Stichen zusammengenäht wurden. Verzierungen und dekorative Elemente verliehen den Kleidungsstücken jedoch ihren besonderen Wert. Archäologische Belege zeigen, dass Stickereien, Brettchenborten und applizierte Seidenstücke häufig verwendet wurden, um Tuniken und Mäntel zu schmücken. Dadurch war Kleidung nicht nur ein Mittel zum Schutz gegen Kälte, sondern auch ein visuelles Zeichen von Rang und Identität. Schneider mussten daher nicht nur handwerklich geschickt sein, sondern auch ein Gespür für Ästhetik und Symbolik haben.
Die archäologischen Funde aus bedeutenden Stätten wie Oseberg, Haithabu, Birka und den Rus-Gebieten liefern eindrucksvolle Belege für die Existenz und das Können der Schneider der Wikingerzeit. Im berühmten Oseberg-Schiffsgrab in Norwegen (834 n. Chr.) fanden Archäologen nicht nur eine prachtvolle Schiffsausstattung, sondern auch Reste von Kleidung, die mit außergewöhnlicher Kunstfertigkeit hergestellt worden war. Seidenfragmente, die teilweise aus Zentralasien oder Byzanz stammten, wurden mit Wollstoffen kombiniert und mit Stickereien und Goldfäden versehen. Diese Funde lassen darauf schließen, dass hier Schneider am Werk waren, die mit importierten Luxusmaterialien umzugehen wussten und Kleidungsstücke schufen, die weit über den reinen Alltagsnutzen hinausgingen – sie waren Statussymbole und Ausdruck von Macht.
In Haithabu, einem der wichtigsten Handelszentren des Nordens, wurden zahlreiche Werkzeuge des Schneiderhandwerks entdeckt, darunter Scheren, Nadeln, Fingerhüte und Textilreste. Die Ausgrabungen dort zeigen, dass es wohl spezialisierte Werkstätten gab, die für die Bevölkerung Kleidung herstellten. Die dort gefundenen Stoffreste geben Einblick in die Vielfalt der Farben und Muster, die durch Pflanzenfärbung erreicht wurden, und bestätigen, dass die Schneider sowohl funktionale als auch repräsentative Kleidung fertigten.
Birka in Schweden liefert die wohl reichsten Belege für die Schneiderkunst der Wikinger. In den über 1.100 dort entdeckten Gräbern fanden sich zahllose Textilreste, die durch Metallfibeln konserviert waren. Besonders bemerkenswert sind die Seiden- und Brokatfunde, die mit Gold- und Silberfäden verziert waren – ein Hinweis darauf, dass die Schneider von Birka nicht nur einfache Kleidung anfertigten, sondern hochkomplexe, aufwändige Gewänder für die Elite. Die Technik der Brettchenborte, die in Birka vielfach nachgewiesen wurde, ist ein Beispiel für die Verknüpfung von Web- und Schneiderkunst.
Auch die Rus, die aus den skandinavischen Siedlungen im heutigen Russland hervorgingen, hinterließen eindrucksvolle Belege. In Kiew, Nowgorod und Gnezdowo wurden Textilien gefunden, die eindeutig skandinavischen Ursprungs sind, darunter seidenverzierte Gewänder und Fragmente mit Stickereien. Diese Funde belegen nicht nur den Handel mit Byzanz, sondern auch die Fähigkeit der skandinavischen Schneider, fremde Materialien und Stilelemente in ihre Arbeit zu integrieren. Damit wird deutlich: Die Schneiderei der Wikingerzeit war ein Handwerk, das auf höchstem Niveau agierte, stark mit dem internationalen Handel verflochten war und dessen Ergebnisse bis heute in den bedeutendsten archäologischen Funden sichtbar sind.
Die Tätigkeit des Schneiders war eng mit dem Leben der Frauen verbunden, da textile Produktion in vielen Fällen in weiblicher Hand lag. Funde aus Frauengräbern mit Nadeln, Scheren und Spinnwirteln zeigen dies deutlich. Doch besonders in größeren Handelszentren wie Haithabu oder Birka lassen sich auch spezialisierte Werkstätten vermuten, die von professionellen Schneidern betrieben wurden.
Kleidung war ein Statussymbol: Ein wohlhabender Jarl trug aufwändige Gewänder aus kostbaren Stoffen, während Bauern einfache Wolltunikas besaßen. Schneider waren damit auch Repräsentationshandwerker, deren Produkte über Ehre, Rang und Einfluss ihres Auftraggebers berichteten.
Neben den archäologischen Funden sind es vor allem zeitgenössische Darstellungen, die uns wertvolle Einblicke in das Schneiderhandwerk und die Kleidung der Wikinger geben. Besonders auf Bildsteinen, Runensteinen und Wandteppichen finden sich Abbildungen von Figuren, deren Kleidung und Gewandung uns Hinweise auf die Arbeit der Schneider liefert.
Ein herausragendes Beispiel ist der Oseberg-Wandteppich, der im berühmten Schiffsgrab von Oseberg entdeckt wurde. Auch wenn er nur fragmentarisch erhalten ist, zeigt er Szenen mit reich gekleideten Figuren, deren Tuniken, Mäntel und Kopfbedeckungen aufwendig gestaltet waren. Diese Darstellungen belegen nicht nur den hohen Stellenwert von Kleidung in rituellen und festlichen Kontexten, sondern auch die Kunstfertigkeit der Schneider, die solche Gewänder schufen. Gerade die Kombination von geometrischen Mustern und farbigen Stoffbahnen lässt Rückschlüsse auf Schnitttechniken und auf die Verwendung von Brettchenborten zu.
Ein weiteres Beispiel ist der Gotländische Bildstein von Stora Hammars, der Szenen aus Mythologie und Alltag zeigt. Hier sind ebenfalls Figuren in langen Gewändern und Mänteln zu sehen, die mit Broschen und Fibeln geschlossen werden. Diese bildlichen Darstellungen bestätigen archäologische Funde von Textilien aus Birka und Haithabu und verdeutlichen, dass Schneider nicht nur Alltagskleidung, sondern auch festliche und symbolträchtige Kleidung für kultische Handlungen anfertigten.
Zusätzlich liefern auch die Darstellungen der Rus in byzantinischen Quellen wie den Chroniken des Konstantin VII. Porphyrogennetos bildliche Hinweise. Er beschreibt und illustriert die Kleidung der skandinavischen Händler und Krieger am Hof von Byzanz, die oft mit prächtigen Tuniken, Gürteln und seidenverzierten Mänteln ausgestattet waren. Diese Quellen sind nicht nur literarisch wertvoll, sondern ergänzen die archäologischen Belege um eine visuelle Dimension, die das Schneiderhandwerk der Wikinger in ein eindrucksvolles Licht rückt.
Der Schneider der Wikingerzeit war ein unverzichtbarer Handwerker, der Kleidung nicht nur als Schutz, sondern als soziales und symbolisches Medium schuf. Archäologische Funde von Nadeln, Scheren, Stoffresten und Stickereien geben uns heute ein klares Bild dieses Berufs. Seine Arbeit verband Funktionalität und Kunstfertigkeit: vom schlichten Leinenhemd bis zum seidenverzierten Mantel eines Jarls. Der Schneider war damit ein Handwerker zwischen Alltag und Status, zwischen Notwendigkeit und Luxus – und seine Kunst ist bis heute in den Funden von Birka, Haithabu und Oseberg erkennbar.
Entdecke die wundervolle Bücherwelt von NorseStory! Hochwertiges Design, fundierte belegbare Inhalte und die facettenreiche Welt der nordischen Mythologie.
Dir gefällt der Blog und der Verlag?
Dann unterstütze unsere Arbeit, Recherche und unser Projekt "NorseStory - auf den Spuren der Wikinger" gerne mit einer PayPal Spende. Jede Spende wird in den Verlag NorseStory investiert.
Ein paar weitere Leseempfehlungen für dich - oder wähle deine nächste Kategorie im Wikinger Blog:
Durchsuche den Wikinger Blog
Blog Kategorien
>> Blog Übersicht
>> Wikinger Runen
>> Wikinger Götter
>> Wikinger Symbole
>> Wikinger Welten
>> Wikinger Tiere
>> Wikinger Begriffe
>> Wikinger Kräuter
>> Wikinger Feiertage
>> Wikinger Geschichten
>> Wikinger Personen
>> Wikinger Waffen
>> Wikinger Rituale
>> Wikinger Berufe
>> Wikinger Edelsteine
>> Wikinger Ereignisse
>> Wikinger Farben
>> Deutsche Burgen
Verlag
Rechtliches
Mehr von uns