
- VERLAG
- MYTHOLOGIE
- DER PFAD DES WISSENS
- SHOP
- KONTAKT

Unter den Göttinnen der nordischen Mythologie nimmt Gefjon eine besondere und zugleich geheimnisvolle Stellung ein. Sie erscheint nicht so häufig wie Freyja oder Frigg, doch in den Erzählungen, die von ihr überliefert sind, entfaltet sich eine außergewöhnliche Kombination von Eigenschaften: Fruchtbarkeit, Schöpfungskraft, Jungfräulichkeit und nationale Identität. Am bekanntesten ist die Legende, in der sie mit Hilfe ihrer zu Stieren verwandelten Söhne einen Teil Schwedens herauspflügt und daraus die dänische Insel Seeland erschafft – ein Mythos, der nicht nur die schöpferische Macht der Göttin, sondern auch die Entstehung einer ganzen Landschaft erklärt. Gefjon steht damit an der Schnittstelle zwischen Mythos, Natur und Nation.
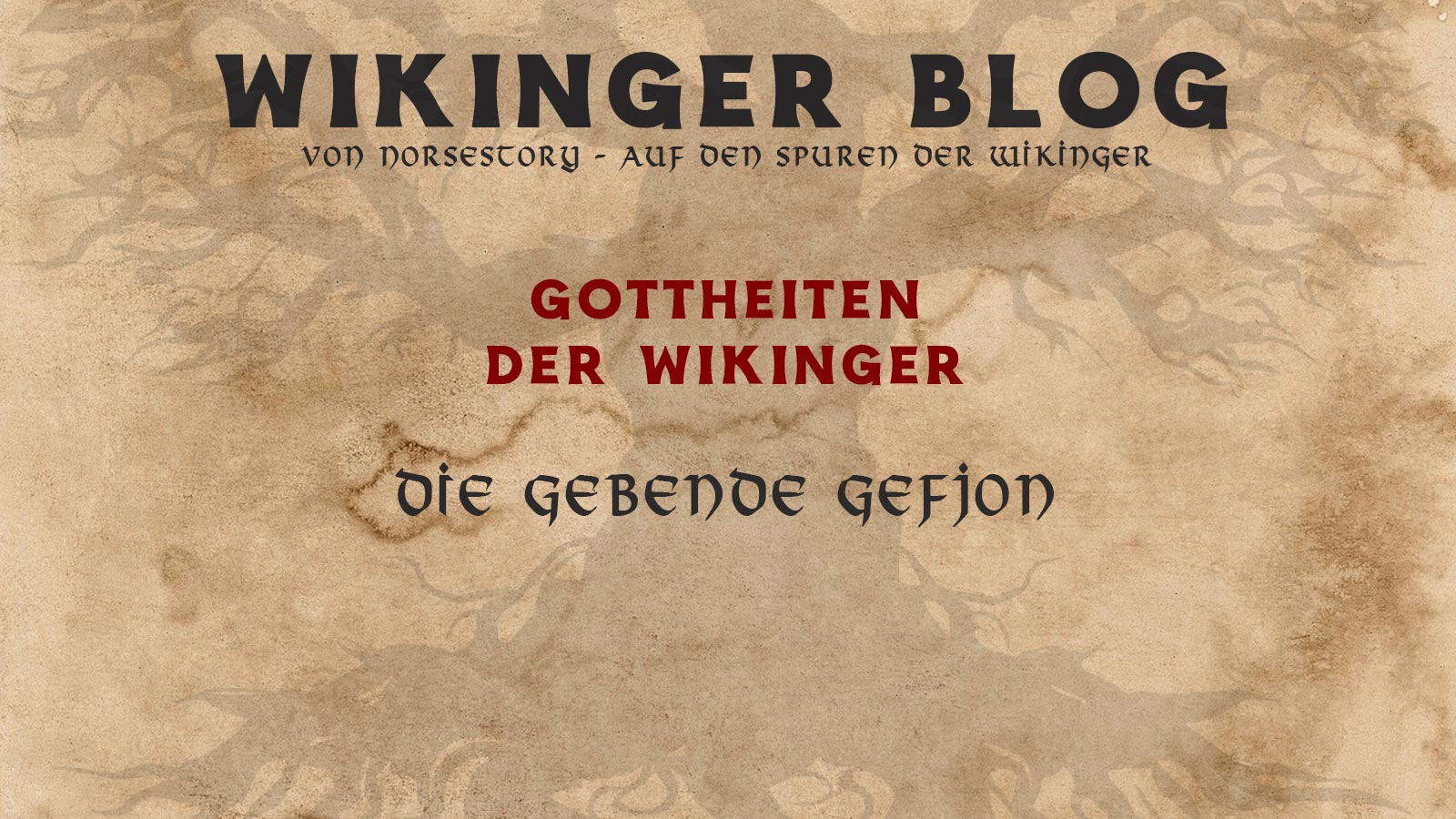
Der Name Gefjon, in den Quellen auch als Gefjun oder Gefion überliefert, wird mit dem altnordischen Verb gefa – „geben“ – in Verbindung gebracht. Er bedeutet wörtlich „die Gebende“ oder „die Spenderin“. Diese sprachliche Wurzel lässt bereits erkennen, dass Gefjon in erster Linie als eine Göttin des Gebens, des Schenkens und der Fruchtbarkeit verstanden wurde. In ihr verdichten sich die Vorstellungen einer Macht, die Leben spendet, Land hervorbringt und den Menschen die Gaben der Natur zuteilwerden lässt. Manche Deutungen gehen sogar noch weiter und sehen in ihrem Namen auch den Hinweis auf ein kultisches Opferverhältnis: Gefjon ist nicht nur die Gebende, sondern auch die Empfängerin von Gaben, die im Opfer an sie zurückgeführt werden.
Die bekannteste Erzählung über Gefjon wird von Snorri Sturluson in der Heimskringla berichtet. Sie spielt im Zusammenhang mit dem schwedischen König Gylfi, der der Göttin ein Landstück versprach – allerdings nur so viel, wie sie in einer einzigen Nacht pflügen könne. Gefjon nahm die Herausforderung an und verwandelte ihre vier Söhne, die sie nach manchen Überlieferungen mit einem Riesen gezeugt hatte, in mächtige Stiere. Mit diesen spannte sie einen Pflug an und grub mit einer solchen Kraft und Tiefe, dass sie einen ganzen Landstrich aus Schweden herausriss. Sie zog ihn ins Meer, wo er zu einer neuen Insel wurde: Seeland, dem Herzstück Dänemarks. Zurück blieb der große Mälarsee in Schweden, dessen Form noch heute an die durch Gefjons Pflug geschaffene Leere erinnert.
Dieser Mythos verdeutlicht gleich mehrere Aspekte ihres Wesens. Zum einen zeigt er ihre Nähe zur Erde und zum Ackerbau, da sie durch den Pflug die Welt verändert und fruchtbares Land hervorbringt. Zum anderen offenbart er ihre Verbindung zu den Grenzen der Welt: Sie kann Land bewegen, Meere füllen und die Geographie verändern – ein Attribut von wahrhaft schöpferischer Macht. Hinzu kommt die List und Klugheit, mit der sie das Versprechen des Königs Gylfi in eine neue, unverrückbare Realität verwandelt.
Darüber hinaus erscheint Gefjon in den Quellen auch als jungfräuliche Göttin. In der Prosa-Edda wird sie als Wächterin genannt, die über die jungfräulichen Toten wacht und ihnen in Odins Halle einen Platz bereitet. Diese Vorstellung verbindet sie mit der Reinheit, der rituellen Unberührtheit und einer besonderen Form von göttlicher Würde. In ihr verschmelzen also zwei scheinbar widersprüchliche Rollen: die gebärende, schöpferische Mutter und die reine Jungfrau. Gerade diese Ambivalenz machte sie in der altnordischen Vorstellungswelt zu einer einzigartigen und verehrungswürdigen Gestalt.
Gefjon stand für die Kraft der Erde, für Fruchtbarkeit und Schöpfung. Besonders Bauern, die auf die Fruchtbarkeit des Bodens angewiesen waren, könnten sie angerufen haben, um eine gute Ernte und einen ertragreichen Ackerbau zu sichern. Die Geschichte vom Pflügen und der Erschaffung Seelands weist sie als eine Schutzpatronin der Landwirtschaft aus. Sie war keine ferne Göttin der Himmelssphären, sondern eine Kraft, die in der Erde selbst lebendig war und deren Macht direkt das Leben der Menschen bestimmte.
In Dänemark, wo sie durch die Legende der Gründung Seelands eine nationale Dimension erhielt, dürfte sie von besonderer Bedeutung gewesen sein. Sie war nicht nur eine Göttin der Fruchtbarkeit, sondern auch eine Identitätsstifterin für das dänische Volk, das seine Ursprünge in ihrer göttlichen Tat sah. Ihre Reinheit verband sie zudem mit Ritualen der kultischen Reinheit: So könnte sie in Zeremonien verehrt worden sein, bei denen Reinheit, Keuschheit oder rituelle Unberührtheit eine Rolle spielten.
Konkrete Hinweise auf einen ausgeprägten Gefjon-Kult sind rar, da die schriftlichen Quellen in erster Linie aus der Zeit nach der Christianisierung stammen. Doch die Mythen und archäologischen Funde lassen Rückschlüsse zu. Als Göttin, die unmittelbar mit Ackerbau, Erde und Pflug in Verbindung stand, ist es wahrscheinlich, dass sie vor allem in Frühlingsritualen und zu Beginn der Aussaat angerufen wurde. In diesen Zeremonien, die oft Opfer von Tieren, Getreide oder auch Met beinhalteten, bat man um eine fruchtbare Erde und um den Segen der Götter für das kommende Jahr.
In Dänemark war ihre Bedeutung besonders stark verankert. Dass noch im 20. Jahrhundert der monumentale Gefion-Brunnen in Kopenhagen errichtet wurde, um die alte Legende im Gedächtnis zu halten, weist auf die tiefe kulturelle Verwurzelung hin. Schon in der Wikingerzeit könnten Prozessionen, Opfergaben und symbolische Pflugriten in ihrem Namen durchgeführt worden sein. Vorstellbar sind Feste, in denen der erste Pflug des Jahres durch ein heiliges Feld gezogen wurde, begleitet von Gesängen, Opfern und Gebeten, die Gefjon gewidmet waren.
Auch die Verbindung zu Jungfräulichkeit und Reinheit legt nahe, dass Gefjon in speziellen Reinheitsriten verehrt wurde. Hier könnten Frauen oder Mädchen, die durch ihre rituelle Unberührtheit besondere Kraft symbolisierten, im Mittelpunkt gestanden haben. So verband sich in ihrem Kult die irdische Fruchtbarkeit mit einer spirituellen Reinheit, die über das Diesseits hinauswies.
Gefjon verkörpert eine Fülle von Symbolen, die ihre Bedeutung weit über die einer gewöhnlichen Fruchtbarkeitsgöttin hinausheben. Sie ist zunächst die Schöpferin von Land. Der Mythos von Seeland macht sie zur Gestalterin ganzer Landschaften – eine Göttin, die nicht nur die Felder fruchtbar macht, sondern die Geographie der Welt verändert. In dieser Rolle erscheint sie fast als kosmische Macht, die Land und Meer ordnet und den Menschen einen neuen Lebensraum schenkt.
Darüber hinaus ist sie die Göttin des Pflugs. Das Pflügen ist ein Akt der Transformation: Der wilde Boden wird gezähmt, um Nahrung hervorzubringen. Gefjon verkörpert diese Kraft der Ordnung, die aus Chaos und Wildnis fruchtbare Erde erschafft. Ihr Pflug ist nicht nur Werkzeug, sondern ein heiliges Symbol der Verbindung zwischen Mensch, Natur und Gottheit.
Gleichzeitig ist sie auch eine Göttin der Reinheit. Als Wächterin der jungfräulichen Toten verkörpert sie ein Ideal, das spirituelle Würde und rituelle Reinheit miteinander verbindet. Ihre Reinheit ist jedoch nicht Schwäche, sondern Stärke: Sie ist die Kraft, die das Heilige bewahrt und die den Übergang in die göttliche Sphäre ermöglicht.
Nicht zuletzt trägt sie eine nationale Symbolik. Für die Dänen wurde Gefjon zur mythischen Mutter, die ihr Land erschuf. Sie war nicht nur eine Fruchtbarkeitsmacht, sondern eine Ahnin, eine Schöpferin des Volkes selbst. In dieser Funktion vereint sie Mythos, Geographie und Identität in einer einzigen Gestalt.
In der heutigen Zeit lebt Gefjon vor allem als Symbolfigur Dänemarks fort. Der monumentale Gefion-Brunnen in Kopenhagen, 1908 errichtet, zeigt sie mit ihren vier Stiersöhnen beim Pflügen – ein nationales Denkmal, das die mythischen Wurzeln des Landes sichtbar macht.
Auch in der spirituellen Wiederbelebung nordischer Religionen, etwa im Ásatrú, wird Gefjon verehrt. Hier gilt sie als Göttin der Fruchtbarkeit, der Landwirtschaft und der schöpferischen Kraft der Erde. Besonders ihre Verbindung von Reinheit und Fruchtbarkeit macht sie zu einer beliebten Figur, die im modernen Glauben eine Brücke zwischen Natur und Spiritualität schlägt.
In der Popkultur tritt sie weniger prominent auf als Freyja oder Frigg, doch ihre Geschichte bleibt ein fester Bestandteil des nordischen Mythenerbes. Gerade in Dänemark wird sie bis heute als nationale Urmutter betrachtet, die das Land Seeland durch göttliche Kraft und List erschuf.
Die Göttin Gefjon ist in mehreren altnordischen Quellen belegt, wobei ihre Rolle je nach Überlieferung unterschiedlich akzentuiert wird. Am bedeutendsten ist ihre Erwähnung in Snorri Sturlusons Heimskringla (13. Jahrhundert), wo die berühmte Sage von der Pflugarbeit erzählt wird, durch die die Insel Seeland entstand. Diese Darstellung ist sowohl eine Mythe kosmischer Schöpfung als auch eine Gründungserzählung für das dänische Königreich.
Auch in der Prosa-Edda findet sich ein Hinweis auf Gefjon, wo sie in der Gylfaginning als Jungfrau beschrieben wird, die über die „jungfräulichen Toten“ wacht und ihnen einen Platz in Odins Halle bereitet. Hier tritt sie in einer eher spirituellen, fast priesterlichen Funktion auf, die ihre Reinheit und Nähe zur Ordnung der Götter betont.
Darüber hinaus taucht ihr Name in einigen Skaldendichtungen und genealogischen Erzählungen auf, wo sie als mythische Ahnin erscheint. So berichtet die Ynglinga saga, dass das dänische Königsgeschlecht von Gefjon abstamme, was ihre Funktion als nationale Muttergestalt unterstreicht.
Archäologisch lassen sich keine eindeutig Gefjon gewidmeten Kultplätze identifizieren, doch die Verknüpfung mit Ackerbau, Erde und Pflug deutet darauf hin, dass sie in Fruchtbarkeitskulten der Wikingerzeit eine Rolle gespielt haben dürfte. Sprachwissenschaftliche Analysen zeigen zudem, dass ihr Name in alten Ortsnamen vorkommt, was auf eine frühere kultische Verehrung hinweist.
Die historischen Quellen machen deutlich, dass Gefjon keine zentrale Göttin des pantheonischen Kults war wie Odin oder Thor, wohl aber eine bedeutende mythische Figur von nationaler und religiöser Strahlkraft, die besonders in Dänemark ihren Platz fand.
Gefjon ist eine Göttin von erstaunlicher Vielschichtigkeit. Sie ist Schöpferin und Jungfrau, Gebende und Empfängerin, kosmische Macht und nationale Ahnin zugleich. Ihr Mythos von der Pflugarbeit, durch die Seeland entstand, macht sie zu einer Schlüsselfigur im Zusammenspiel von Mythos, Natur und Identität. Auch wenn ihr Kult nicht so umfangreich dokumentiert ist wie der Freyjas oder Friggs, zeigt ihre Gestalt, wie facettenreich die nordische Vorstellungswelt war und wie stark sie Natur, Gesellschaft und Religion miteinander verband. Gefjon bleibt die Gebende, die nicht nur Land erschafft, sondern auch Sinn, Identität und spirituelle Ordnung schenkt.
Entdecke die wundervolle Bücherwelt von NorseStory! Hochwertiges Design, fundierte belegbare Inhalte und die facettenreiche Welt der nordischen Mythologie.
Dir gefällt der Blog und der Verlag?
Dann unterstütze unsere Arbeit, Recherche und unser Projekt "NorseStory - auf den Spuren der Wikinger" gerne mit einer PayPal Spende. Jede Spende wird in den Verlag NorseStory investiert.
Ein paar weitere Leseempfehlungen für dich - oder wähle deine nächste Kategorie im Wikinger Blog:
Durchsuche den Wikinger Blog
Blog Kategorien
>> Blog Übersicht
>> Wikinger Runen
>> Wikinger Götter
>> Wikinger Symbole
>> Wikinger Welten
>> Wikinger Tiere
>> Wikinger Begriffe
>> Wikinger Kräuter
>> Wikinger Feiertage
>> Wikinger Geschichten
>> Wikinger Personen
>> Wikinger Waffen
>> Wikinger Rituale
>> Wikinger Berufe
>> Wikinger Edelsteine
>> Wikinger Ereignisse
>> Wikinger Farben
>> Deutsche Burgen
Verlag
Rechtliches
Mehr von uns