
- VERLAG
- MYTHOLOGIE
- DER PFAD DES WISSENS
- SHOP
- KONTAKT

Unter den zahlreichen Ritualen der Wikingerzeit nimmt das Trankopfer, im Altnordischen Sumbel genannt, eine besondere Stellung ein. Es war mehr als nur ein gemeinsames Trinken – es war ein heiliger Akt, der die Bindung zwischen Menschen, Ahnen und Göttern festigte. Bei Festen, Blóts oder bedeutenden Zusammenkünften wurde der Trinkhorn-Kreis zum Mittelpunkt des rituellen Geschehens, bei dem Worte, Eide und Gelöbnisse ebenso wichtig waren wie der Trank selbst.
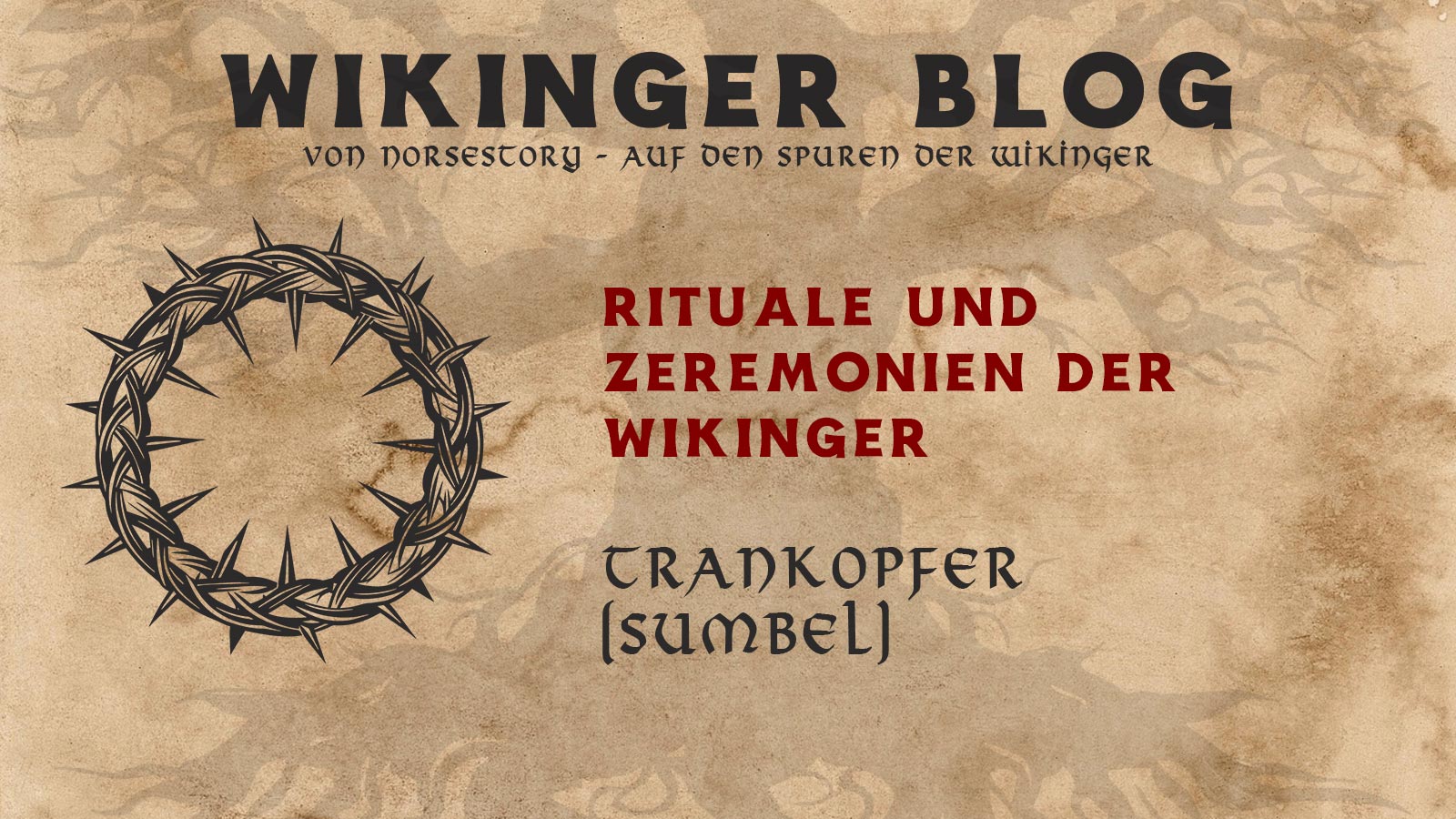
Der Begriff Sumbel verweist auf ein rituellen Trinkgelage, das seine Wurzeln tief in der germanisch-skandinavischen Tradition hatte. Anders als ein bloßes Festmahl war es ein Akt der Weihe: Trank wurde nicht nur genossen, sondern in geordneter Weise den Göttern, den Ahnen und den Geistern dargebracht. Das gemeinsame Weiterreichen des Horns symbolisierte den Kreis des Lebens und die Verbindung der Gemeinschaft.
Trankopfer kannten viele indoeuropäische Kulturen – in der nordischen Tradition verbanden sie besonders die Vanen und Asen mit den Menschen. Met, Bier oder Wein wurden dabei nicht zufällig gewählt: Sie galten als „Seelenspeise“, als Gaben der Erde und Fruchtbarkeit, die durch Opfergabe geheiligt wurden.
Das Sumbel war streng geordnet und folgte einer klaren Abfolge, die das Profane vom Heiligen unterschied. Zu Beginn wurde das Trinkhorn mit Met, Bier oder, in seltenen Fällen, Wein gefüllt und feierlich geweiht. Der Gastgeber oder ein Priester – oft ein Gothi – erhob das Horn, sprach eine Anrufung und segnete den Trank, sodass er nicht mehr nur Getränk, sondern ein Medium zwischen Mensch und Gottheit war. Danach setzte sich die Runde in Bewegung: Das Horn wanderte in einer festen Reihenfolge von Hand zu Hand, jeder Teilnehmer nahm es mit beiden Händen entgegen, trank einen Schluck und sprach Worte, die Gewicht hatten.
Die erste Runde galt traditionell den Göttern. Hier wurden Odin, Thor, Freyr oder andere Gottheiten angerufen, ihre Macht gepriesen und um Schutz und Beistand gebeten. Mit dem zweiten Umtrunk richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Ahnen. Verstorbene Familienmitglieder, gefallene Krieger und verehrte Stammesführer wurden geehrt, indem ihre Namen genannt, Geschichten erzählt und Dank ausgesprochen wurde. Erst in der dritten Runde öffnete sich der Kreis für das Persönliche: Jetzt legten die Teilnehmer Schwüre ab, gelobten Taten oder verkündeten Versprechen, die vor der Gemeinschaft und vor den Göttern bindend wurden.
Zwischen den Runden erklangen oft Gesänge und Galdr, rituelle Formeln oder Gedichte, die die Kraft der Worte verstärkten. Das Horn durfte niemals willkürlich weitergereicht oder übersprungen werden – die Ordnung des Kreises war Ausdruck der kosmischen Ordnung, und eine Unterbrechung galt als Störung des Rituals. Jeder, vom höchsten Jarl bis zum einfachen Krieger, erhielt das Horn, und so wurden alle Teilhaber einer zeremoniellen Kette, die das Band zwischen Göttern, Ahnen und der lebenden Gemeinschaft festigte. Das Sumbel war damit nicht nur ein rituelles Trinken, sondern ein feierlicher Akt, in dem Wort, Trank und Gemeinschaft zu einer Einheit verschmolzen.
Das Trankopfer war nicht nur ein religiöses Ritual, sondern auch ein soziales Bindemittel. Hier wurden Allianzen bekräftigt, Treueschwüre gesprochen und Versprechen vor der Gemeinschaft öffentlich gemacht. Ein im Sumbel abgelegter Eid galt als besonders verpflichtend – wer ihn brach, verlor nicht nur Ehre, sondern stellte sich gegen die Götter selbst.
Darüber hinaus schuf das Ritual ein Gefühl der Gleichheit: Ob Jarl oder einfacher Krieger, jeder erhielt das Horn und damit die Gelegenheit, Teil der spirituellen Gemeinschaft zu sein. Damit war das Sumbel ein wichtiges Instrument zur Stärkung von Loyalität und Zusammenhalt.
Archäologisch sind Trankopfer schwerer zu fassen, da die Flüssigkeiten selbst vergangen sind. Doch Ritualhörner aus Gold, Silber und kunstvoll verziertem Horn – wie das berühmte Gallehus-Horn aus Dänemark – zeigen, welch zentrale Rolle sie spielten. Funde aus Gräbern, in denen Trinkhörner mitgegeben wurden, unterstreichen den spirituellen Wert solcher Gefäße.
In den schriftlichen Quellen wird das Sumbel mehrfach erwähnt. In der Beowulf-Dichtung ist die rituelle Trinkrunde im Königssaal ein zentraler Bestandteil der Handlung. Auch in der Edda und den Sagas finden sich Hinweise, dass Trankopfer als kultischer Höhepunkt bei Gelagen verstanden wurden – ein Moment, in dem das Profane ins Heilige überging.
Das Sumbel verkörpert die Verbindung von Erde, Mensch und Gottheit. Das Getränk, gewachsen aus Korn, Honig oder Früchten, wurde durch die Opfergabe in ein Band zwischen den Welten verwandelt. Das Horn symbolisierte dabei nicht nur Überfluss und Fruchtbarkeit, sondern auch die kosmische Ordnung, in der jeder Teilnehmer ein Glied der Gemeinschaft war.
Der Schwur im Sumbel war nicht nur eine menschliche Handlung, sondern wurde als Bindung vor den Augen der Götter verstanden. So hatte das Ritual eine tiefgreifende rechtliche, soziale und religiöse Dimension.
Auch heute noch wird das Sumbel in neopaganen und Ásatrú-Gemeinschaften praktiziert. Dabei folgen viele Gruppen bewusst der alten Struktur: Opfer an die Götter, Ehrung der Ahnen und persönliche Gelöbnisse. Moderne Trankopfer sind oft festlicher Teil von Jahreskreisfesten wie Jul oder Midsommar.
Die Wiederentdeckung des Sumbels zeigt das zeitlose Bedürfnis nach Gemeinschaft, Bindung und Spiritualität. Ob in kleinen Gruppen oder bei großen heidnischen Treffen – das Ritual hat seine Kraft nicht verloren und inspiriert bis heute jene, die den alten Wegen folgen.
Das Trankopfer (Sumbel) war ein zentrales Ritual der Wikinger, das Gemeinschaft, Religion und soziale Ordnung verband. Es war mehr als ein Gelage: Es war ein heiliger Akt, bei dem Trank zu einem Medium zwischen Menschen, Göttern und Ahnen wurde. Funde von Trinkhörnern und literarische Zeugnisse wie Beowulf belegen seine Bedeutung. Noch heute lebt das Ritual in modernen Traditionen fort – als Symbol für Treue, Gemeinschaft und die Kraft des Wortes.
Entdecke die wundervolle Bücherwelt von NorseStory! Hochwertiges Design, fundierte belegbare Inhalte und die facettenreiche Welt der nordischen Mythologie.
Dir gefällt der Blog und der Verlag?
Dann unterstütze unsere Arbeit, Recherche und unser Projekt "NorseStory - auf den Spuren der Wikinger" gerne mit einer PayPal Spende. Jede Spende wird in den Verlag NorseStory investiert.
Ein paar weitere Leseempfehlungen für dich - oder wähle deine nächste Kategorie im Wikinger Blog:
Durchsuche den Wikinger Blog
Blog Kategorien
>> Blog Übersicht
>> Wikinger Runen
>> Wikinger Götter
>> Wikinger Symbole
>> Wikinger Welten
>> Wikinger Tiere
>> Wikinger Begriffe
>> Wikinger Kräuter
>> Wikinger Feiertage
>> Wikinger Geschichten
>> Wikinger Personen
>> Wikinger Waffen
>> Wikinger Rituale
>> Wikinger Berufe
>> Wikinger Edelsteine
>> Wikinger Ereignisse
>> Wikinger Farben
>> Deutsche Burgen
Verlag
Rechtliches
Mehr von uns