
- VERLAG
- MYTHOLOGIE
- SHOP
- KONTAKT

Unter den vielen Begriffen der nordischen Mythologie nimmt Fólkvangr („das Feld des Volkes“ oder „das Volkfeld“) eine besondere Rolle ein. Während die meisten Menschen die Walhalla als Ort kennen, an dem die gefallenen Krieger einkehren, wissen nur wenige, dass es eine zweite Stätte gab, in der die tapfersten Gefallenen Aufnahme fanden: Fólkvangr, die Halle der Göttin Freyja. Dieser Ort, der in den eddischen Schriften beschrieben wird, zeigt, wie vielfältig und komplex die jenseitige Vorstellungswelt der Wikinger war.
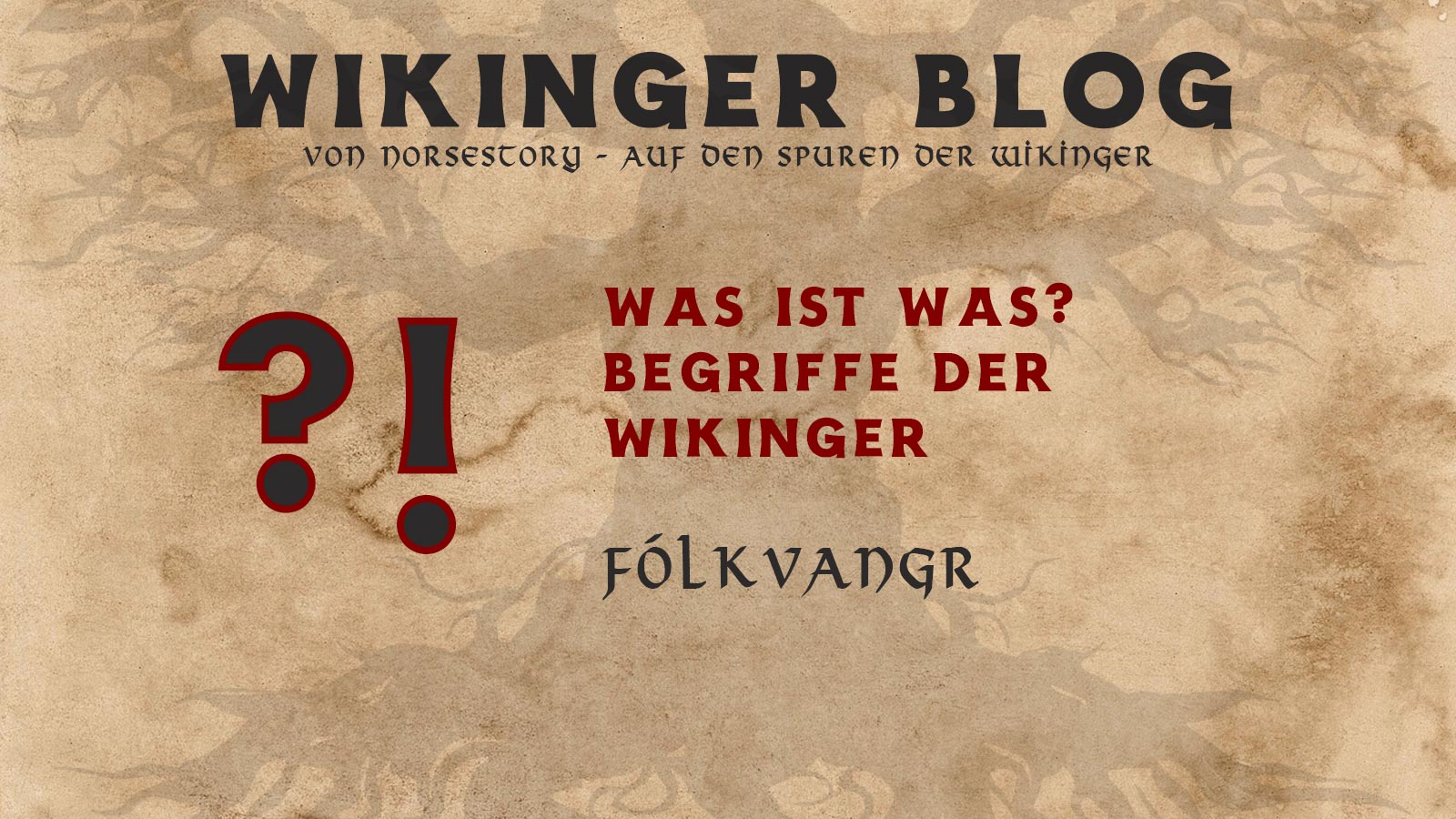
Das Wort Fólkvangr entstammt dem Altnordischen und setzt sich aus fólk (Volk, Menschen, Krieger) und vangr (Feld, Ebene) zusammen. Übersetzt bedeutet es „Feld des Volkes“ oder „Ebene des Kampfvolkes“. In der Lieder-Edda, genauer in der Grímnismál, wird Fólkvangr als Freyjas Reich beschrieben. Dort heißt es, dass Freyja die Hälfte der gefallenen Krieger nach einer Schlacht erhält, während die andere Hälfte nach Walhalla zu Odin kommt. Schon in dieser sprachlichen und mythologischen Deutung wird Fólkvangr als ein Reich der Tapferkeit und des Todes sichtbar, aber zugleich auch als ein Bereich der Liebe, Fürsorge und Schönheit, da Freyja über ihn herrscht.
Die Erwähnung von Fólkvangr in den eddischen Texten – insbesondere in der Grímnismál – ist von großer Bedeutung, weil sie zeigt, dass die Wikinger die Vorstellung vom Jenseits keineswegs einheitlich verstanden. Während viele Menschen Walhalla als den ultimativen Bestimmungsort aller gefallenen Krieger wahrnehmen, ist dies nur die halbe Wahrheit. Die Quellen betonen, dass Freyja, die Göttin der Liebe, Schönheit, Magie und des Krieges, ebenso das Recht hatte, über die Toten der Schlacht zu bestimmen. Genau darin liegt die Funktion von Fólkvangr: Es ist nicht lediglich eine zweite Ruhestätte neben Walhalla, sondern eine eigenständige und gleichwertige Sphäre des Jenseits.
Die Auswahl, wer nach Fólkvangr gelangte, war ein göttlicher Akt der Entscheidung durch Freyja selbst. Das bedeutete, dass nicht allein Kampfesmut oder Ruhm im Krieg entscheidend waren, sondern auch jene Eigenschaften, die Freyja schätzte: Leidenschaft, Mut, Schönheit, Wille und magische Begabung. Insofern wird Fólkvangr oft als ein Ort verstanden, an dem eine andere Form von Tapferkeit belohnt wurde – nicht nur die rohe Stärke, sondern auch die innere Größe eines Menschen. Diese Funktion macht Fólkvangr zu einem faszinierenden Spiegel der nordischen Gesellschaft, in der Kriegerideal und spirituelle Tiefe nebeneinander existierten.
Die Existenz von Fólkvangr relativiert die Vorstellung, dass Odin alleiniger Herrscher über die Gefallenen sei. Stattdessen präsentiert sich eine Dualität im Jenseits: Während Odin in Walhalla die Krieger für Ragnarök sammelte, um sie in der letzten Schlacht gegen die Mächte des Chaos an seiner Seite kämpfen zu lassen, nahm Freyja in Fólkvangr jene Hälfte der Gefallenen auf, die ihr besonders würdig erschien. Diese Verteilung – „die eine Hälfte zu Odin, die andere zu Freyja“ – zeigt, dass das Schicksal der Gefallenen nicht ausschließlich von Kampf und Kriegsherrlichkeit bestimmt war, sondern auch vom Willen und der Gunst der Götter.
Besonders spannend ist, dass Freyjas Reich in den Quellen oft gleichwertig zu Walhalla dargestellt wird, nicht als dessen „zweitrangiges Gegenstück“. Fólkvangr verkörpert eine andere Dimension des Jenseits, die ebenso Ruhm und Ehre, aber auch Fürsorge, Weiblichkeit und Magie umfasst. Damit wird deutlich, dass die nordische Mythologie nicht eindimensional war, sondern verschiedene Zugänge zur Nachwelt kannte. Für die Wikinger war dies eine Art kosmisches Gleichgewicht: Der männliche, auf Krieg ausgerichtete Aspekt Odins und der weibliche, lebensbejahende, aber ebenso kampfbereite Aspekt Freyjas ergänzten sich zu einem umfassenden Bild des Jenseits.
Die Symbolik von Fólkvangr ist reich und vielschichtig. Auf der einen Seite steht der Ort für den Tod im Krieg, für Blut, Mut und das Opfer auf dem Schlachtfeld. Doch gleichzeitig wird er von Freyja, der Göttin der Liebe, Sexualität und Fruchtbarkeit, regiert – eine Verbindung, die auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint, in Wahrheit aber das Herzstück der nordischen Religion offenbart. Denn hier verschmelzen Krieg und Liebe, Tod und Schönheit, Zerstörung und Fruchtbarkeit zu einer einzigen Einheit.
Fólkvangr ist damit das Sinnbild einer kosmischen Balance, in der das Leben in all seinen Gegensätzen vereint ist. Er zeigt, dass es in der nordischen Vorstellungswelt kein reines Schwarz und Weiß gab, sondern dass jeder Sieg, jedes Opfer, jeder Tod auch eine Form von Schönheit und Erneuerung in sich trug. Für die Menschen, die an Fólkvangr glaubten, bedeutete er daher nicht nur einen Ort des Nachruhms, sondern auch ein Versprechen von Geborgenheit und Vollkommenheit – nicht durch endlose Schlacht, sondern durch die Nähe zu Freyja selbst.
In der heutigen Zeit hat Fólkvangr eine bemerkenswerte Wiederentdeckung erfahren, besonders in neopaganen Bewegungen wie Ásatrú. Hier wird er oft als Gegenpol zu Walhalla verstanden: Während Walhalla für die Härte, den Krieg und das letzte Gefecht steht, symbolisiert Fólkvangr Liebe, Magie, Weiblichkeit und spirituelle Transformation. Viele moderne Anhänger empfinden ihn daher als „menschlicheren“ Ort des Jenseits, an dem Herz und Seele ebenso zählen wie Waffenstärke.
Auch in der Popkultur taucht Fólkvangr zunehmend auf. In Fantasy-Literatur, Rollenspielen und Videospielen dient er als mystischer Ort, der nicht nur Kampf, sondern auch Leidenschaft und Schönheit in den Mittelpunkt stellt. In der Musik – vor allem in Pagan- und Viking-Metal – wird er als mythisches Bild für Tod und Wiedergeburt genutzt. Diese Rezeption verdeutlicht, dass Fólkvangr heute als Symbol für die Vielfalt der nordischen Mythologie verstanden wird. Er steht nicht nur für die Kriegergesellschaft der Wikinger, sondern für die tiefe Erkenntnis, dass das Leben immer aus Gegensätzen gewebt ist: aus Krieg und Liebe, aus Opfer und Belohnung, aus Tod und neuer Blüte.
Fólkvangr ist das Reich der Göttin Freyja, in dem die Hälfte der gefallenen Krieger nach einer Schlacht Aufnahme findet. Der Begriff bedeutet „Feld des Volkes“ und verweist auf seine Rolle als Jenseitsort neben Walhalla. Fólkvangr symbolisiert die Dualität der nordischen Weltanschauung: Krieg und Liebe, Tod und Schönheit. In der Begriffskunde der Wikinger zeigt Fólkvangr, dass der Tod nicht nur eine Fortsetzung des Kampfes war, sondern auch eine Begegnung mit der göttlichen Liebe und Magie.
Entdecke die wundervolle Bücherwelt von NorseStory! Hochwertiges Design, fundierte belegbare Inhalte und die facettenreiche Welt der nordischen Mythologie.
Dir gefällt der Blog und der Verlag?
Dann unterstütze unsere Arbeit, Recherche und unser Projekt "NorseStory - auf den Spuren der Wikinger" gerne mit einer PayPal Spende. Jede Spende wird in den Verlag NorseStory investiert.
Ein paar weitere Leseempfehlungen für dich - oder wähle deine nächste Kategorie im Wikinger Blog:
Durchsuche den Wikinger Blog
Blog Kategorien
>> Blog Übersicht
>> Wikinger Runen
>> Wikinger Götter
>> Wikinger Symbole
>> Wikinger Welten
>> Wikinger Tiere
>> Wikinger Begriffe
>> Wikinger Kräuter
>> Wikinger Feiertage
>> Wikinger Geschichten
>> Wikinger Personen
>> Wikinger Waffen
>> Wikinger Rituale
>> Wikinger Berufe
>> Wikinger Edelsteine
>> Wikinger Ereignisse
>> Wikinger Farben
>> Deutsche Burgen
Verlag
Rechtliches
Mehr von uns