
- VERLAG
- MYTHOLOGIE
- SHOP
- KONTAKT

Im Jahr 835 n. Chr. veränderte sich die politische Landkarte Nordeuropas grundlegend. Nachdem die Wikinger bereits seit Jahrzehnten vereinzelte Küstenorte in England und Irland überfallen hatten, richteten sie ihren Blick nun auf das europäische Festland – auf die reichen Küstengebiete des Frankenreiches, insbesondere Frisia (das heutige Friesland und die niederländisch-deutsche Nordseeküste) sowie die Flussläufe des Rheins. Diese Überfälle markieren den Beginn einer neuen Epoche: Die Wikinger traten nicht mehr nur als räuberische Plünderer auf, sondern begannen, systematisch zu erobern, zu kontrollieren und zu siedeln. Sie nutzten die Wasserwege als strategische Zugangsadern ins Herz Europas – und zwangen das mächtige Karolingerreich in die Defensive.
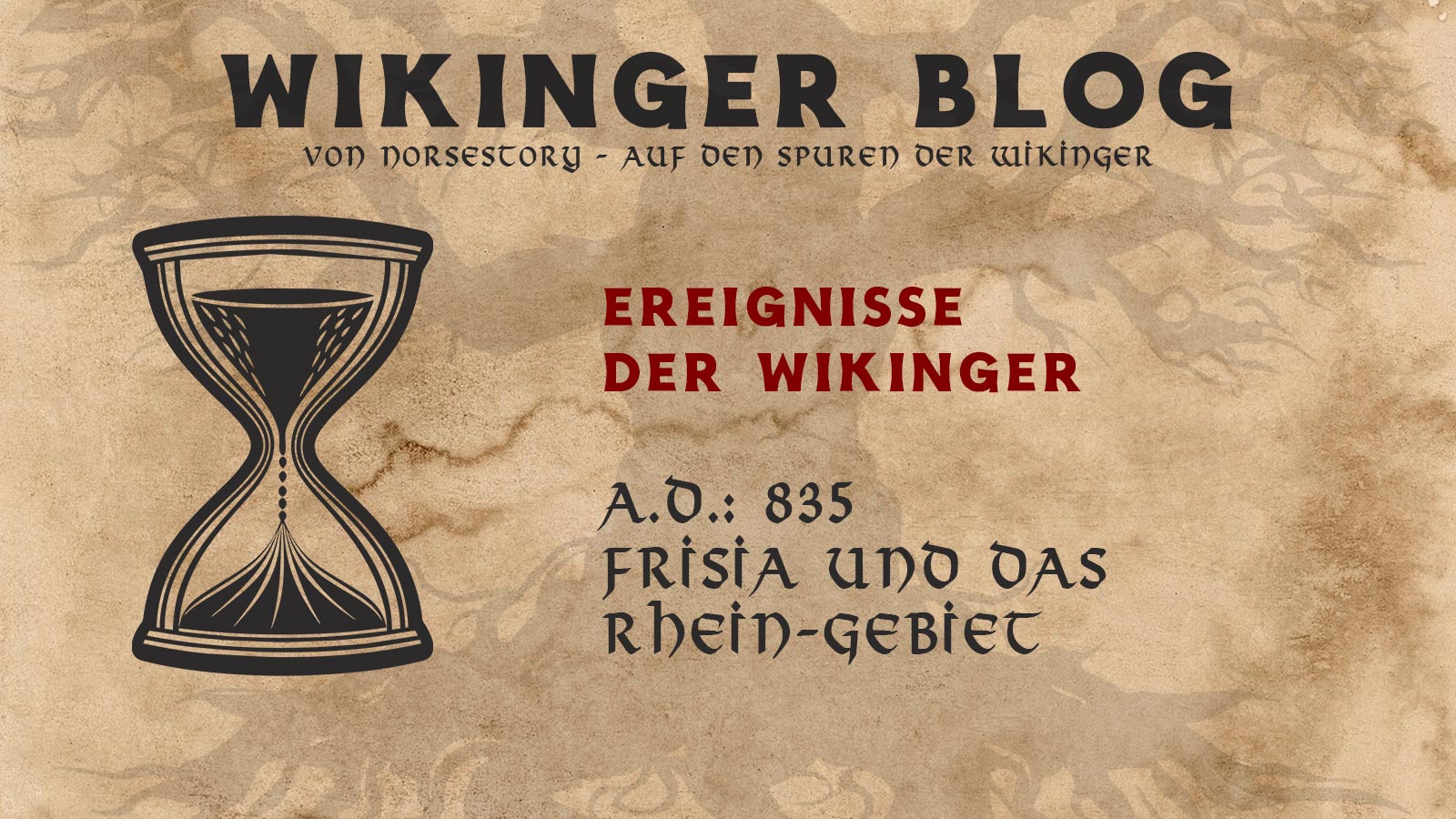
Die frühen 830er Jahre waren für das Frankenreich eine Zeit politischer Instabilität. Nach dem Tod Karls des Großen war sein Reich zwischen seinen Nachfolgern aufgeteilt worden, und Ludwig der Fromme kämpfte mit inneren Machtkonflikten, Aufständen seiner Söhne und schwankender Autorität.
In dieser Phase der Schwäche erkannten die skandinavischen Fürsten ihre Chance. Sie kannten die Handelsrouten, sie wussten um den Reichtum der Küstenstädte und Klöster – und sie verfügten über eine Waffe, die Europa kaum aufzuhalten wusste: ihre Langschiffe.
Diese Schiffe ermöglichten es, sowohl auf offener See als auch auf Flüssen zu operieren. Innerhalb weniger Tage konnten die Wikinger vom Meer bis tief ins Binnenland vordringen. Der Rhein, der Ems, die Weser und die Elbe wurden zu neuen Verkehrsadern ihrer Eroberungszüge.
Im Jahr 835 landeten mehrere Wikingerflotten an der friesischen Küste. Zeitgenössische Quellen – darunter die Annales Fuldenses und die Annales Bertiniani – berichten von schweren Verwüstungen entlang der Nordseeküste. Städte und Klöster wie Dorestad, Witla, Egmond und die Umgebung von Utrecht wurden geplündert und niedergebrannt.
Frisia, einst ein bedeutendes Handelszentrum des fränkischen Nordens, war ein attraktives Ziel. Hier kreuzten sich Handelswege zwischen Skandinavien, dem Rheinland und Britannien. Gold, Silber, Textilien und Sklaven waren begehrte Beute. Die Wikinger wussten, dass ihre Angriffe in diesen Regionen besonders lohnend waren – und dass die fränkischen Garnisonen nur schwach besetzt waren.
Doch die Angriffe auf Frisia waren mehr als bloße Raubzüge. Sie zeigen eine deutliche militärische Organisation: Flotten, die gleichzeitig an mehreren Orten landeten, strategisch koordiniert vorgingen und ihre Rückzüge über die Flüsse absicherten. Dies deutet darauf hin, dass die Wikinger zu diesem Zeitpunkt bereits über erfahrene Heerführer und politische Planung verfügten.
Nach den Küstenregionen wandten sich die Wikinger den großen Flüssen zu. Der Rhein, als Lebensader des Frankenreiches, wurde zum Tor für weitere Überfälle. Die Schiffe drangen tief in das Binnenland vor, erreichten Handelszentren, befestigte Orte und reiche Klöster.
Die Chroniken berichten von Angriffen auf Utrecht, Nijmegen, Köln und weiter rheinabwärts auf fränkische Besitzungen. Der Rheingau, die Region um Mainz, Bonn und Xanten, wurde zum Brennpunkt der Verwüstungen. Klöster – Orte geistiger Bildung und Reichtumszentren – waren bevorzugte Ziele. Ihre Reliquien und Schätze wurden geplündert, ihre Bewohner gefangen genommen oder getötet.
Die Flüsse wurden für die Wikinger zu strategischen Angriffsachsen, die ihnen Beweglichkeit verschafften, wie sie kein fränkisches Heer aufbringen konnte. Die Langschiffe konnten bei Flut weit ins Binnenland fahren, bei Ebbe wieder verschwinden – kaum eine Armee war ihnen gewachsen.
Die Überfälle trafen das Frankenreich völlig unvorbereitet. Ludwig der Fromme reagierte zunächst mit diplomatischen Maßnahmen. In einigen Fällen zahlte er Tribut (Danegeld), um die Angreifer zum Rückzug zu bewegen – ein Muster, das später auch in England zu einer gängigen Praxis werden sollte.
Doch diese Zahlungen waren nur ein kurzfristiges Mittel. Sie ermutigten die Wikinger, noch häufiger zurückzukehren. Schon in den folgenden Jahren wiederholten sich die Angriffe: 836, 837 und 840 verwüsteten neue Flotten die Rheinregion und die friesischen Küsten erneut. Die Klöster von Noirmoutier und Dorestad wurden mehrfach Opfer der Plünderungen.
Erst Jahrzehnte später – unter Karl dem Kahlen – begann das Frankenreich mit dem Aufbau fester Küstenverteidigungen und dem Einsatz von Flottenverbänden gegen die Nordmänner. Doch im Jahr 835 war die Welle nicht mehr aufzuhalten – die Wikinger hatten ihren Fuß in Europa gesetzt.
Die Überfälle des Jahres 835 zeigen deutlich, dass die Wikinger nicht nur auf rohe Gewalt setzten, sondern auf schnelle, taktisch präzise Operationen. Sie kamen überraschend, griffen gezielt an und verschwanden ebenso schnell.
Ihre Langschiffe waren technische Meisterwerke: leicht, stabil und in der Lage, selbst in seichten Gewässern zu fahren. Damit konnten sie sowohl die offenen Meere als auch enge Flussläufe nutzen – eine Mobilität, die den fränkischen Reitern und Fußsoldaten fehlte.
Der Angriff erfolgte meist im Morgengrauen, oft während religiöser Feiertage, wenn die Klöster unbewacht waren. Die Wikinger zerstörten die Vorräte, raubten Vieh, Gold und Silber, nahmen Gefangene und zogen sich zurück, bevor Gegenwehr organisiert werden konnte.
Diese Strategie, kombiniert mit der politischen Zersplitterung des Frankenreichs, machte sie zu einer der größten militärischen Bedrohungen des 9. Jahrhunderts.
Die Ereignisse des Jahres 835 markieren den Beginn der kontinentalen Wikingerexpansion. Was zunächst als Serie von Plünderungen begann, entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem großflächigen Eroberungs- und Siedlungsprozess.
In den friesischen Gebieten etablierten die Nordmänner zeitweise feste Stützpunkte, von denen aus sie Handel und Raubzüge betrieben. Diese Basen bildeten die Grundlage für spätere Expansionen nach Frankreich, ins Rheinland, nach Lothringen und bis ins Binnenland Deutschlands.
Die Überfälle von 835 zeigten, dass kein Ort im Westen mehr sicher war. Der Mythos vom „Rand der Welt“, den die Wikinger überschritten, wurde zu einer politischen Realität: Europa war durchlässig geworden.
Zudem begannen durch diese Kontakte auch kulturelle und wirtschaftliche Austauschprozesse – Handel, Sprache, Technologie und sogar Kunstformen verbreiteten sich über die skandinavischen und fränkischen Grenzen hinaus.
Archäologische Funde entlang der niederländischen und deutschen Nordseeküste bestätigen die historischen Berichte. In der Region um Dorestad, einem der wichtigsten Handelszentren des Frühmittelalters, fanden Forscher Brandspuren, Waffenteile und Münzfunde, die mit den Überfällen der Wikinger in Verbindung gebracht werden.
Auch an den Flussufern des Rheins wurden Spuren von Brandschichten und Plünderungen gefunden, die auf diese Zeit zurückgehen. Besonders interessant sind Münzfunde mit skandinavischen Prägungen – ein Hinweis darauf, dass die Wikinger nicht nur raubten, sondern auch handelten und Münzen aus verschiedenen Regionen in Umlauf brachten.
Die wichtigsten schriftlichen Zeugnisse stammen aus den karolingischen Annalen, insbesondere den Annales Fuldenses, Annales Bertiniani und Chronicon Moissiacense. Diese Quellen beschreiben die Überfälle mit Entsetzen, aber auch mit einer gewissen Faszination – sie zeigen, wie sehr das Auftreten der Nordmänner das mittelalterliche Europa erschütterte.
Die Überfälle von 835 n. Chr. markieren nicht nur eine historische Zäsur, sondern den Beginn der Wikingerzeit auf dem europäischen Festland. Von den Küsten Frisiens bis zu den Ufern des Rheins machten die Nordmänner deutlich, dass ihre Macht weit über Skandinavien hinausreichte. Was mit diesen Angriffen begann, entwickelte sich zu einer jahrhundertelangen Phase von Kriegszügen, Kolonisation und kultureller Verschmelzung. Die Wikinger wurden zu einem festen Bestandteil der europäischen Geschichte – als Krieger, Händler und Entdecker. Das Jahr 835 steht daher symbolisch für den Moment, in dem sich die Grenzen Europas öffneten – nicht nur durch Eroberung, sondern auch durch Austausch, Begegnung und Wandel.
Entdecke die wundervolle Bücherwelt von NorseStory! Hochwertiges Design, fundierte belegbare Inhalte und die facettenreiche Welt der nordischen Mythologie.
Dir gefällt der Blog und der Verlag?
Dann unterstütze unsere Arbeit, Recherche und unser Projekt "NorseStory - auf den Spuren der Wikinger" gerne mit einer PayPal Spende. Jede Spende wird in den Verlag NorseStory investiert.
Ein paar weitere Leseempfehlungen für dich - oder wähle deine nächste Kategorie im Wikinger Blog:
Durchsuche den Wikinger Blog
Blog Kategorien
>> Blog Übersicht
>> Wikinger Runen
>> Wikinger Götter
>> Wikinger Symbole
>> Wikinger Welten
>> Wikinger Tiere
>> Wikinger Begriffe
>> Wikinger Kräuter
>> Wikinger Feiertage
>> Wikinger Geschichten
>> Wikinger Personen
>> Wikinger Waffen
>> Wikinger Rituale
>> Wikinger Berufe
>> Wikinger Edelsteine
>> Wikinger Ereignisse
>> Wikinger Farben
>> Deutsche Burgen
Verlag
Rechtliches
Mehr von uns